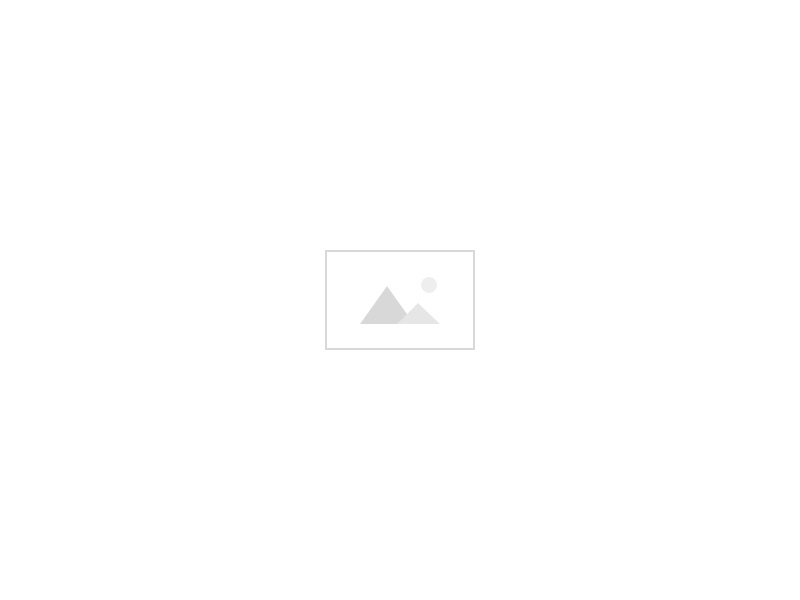Wie Personalverantwortliche ihre Mitarbeiter*innen individuell fördern und gleichzeitig etwas für eine offene Team-Kommunikation tun können.
„Meine Kollegin meinte, sie würde sich nicht trauen, an diesem Kurs hier teilzunehmen.“
„Echt? Du hast deinen Kolleg*innen davon erzählt, dass du hier teilnimmst? Das würde ich gar nicht erzählen.“
Dieser kurze Dialog zweier Teilnehmender meines offenen Kurses „Sprechunsicherheiten bewältigen“ hat mich nachdenklich gestimmt. So sehr, dass er mich immer wieder beschäftigt. Denn eigentlich wünschte ich, wir wären im Berufsleben offener …
Insgesamt offener, was Akzeptanz und gegenseitige Unterstützung betrifft: Ein wertschätzendes Klima, in dem Mitarbeiter*innen ihre (vermeintlichen) persönlichen wie beruflichen Schwächen offen kommunizieren können, so dass sie motiviert ihre Kompetenzen weiterentwickeln und auch selbstbewusst an ihren Schwächen arbeiten können.
Jedenfalls fand ich es bedauerlich zu hören, dass die Teilnahme an meinem Kurs offenbar auch mit Scham behaftet war, zumindest wenn es den Teilnehmer*innen um ihr direktes professionelles Umfeld ging. Meine Reaktion war daher vielleicht ein wenig zu energisch: „Was ist denn so schlimm daran zuzugeben, an einem Rhetorik-Kurs gegen Sprechunsicherheiten und Lampenfieber teilzunehmen? Das ist doch super! Stark und selbstbewusst!“
Was mich seit diesem Gespräch vor allem umtreibt, sind drei Fragen:
- Wie hoch ist wohl die „Dunkelziffer“ von eigentlich engagierten Mitarbeiter*innen, die von einer wie auch immer ausgeprägten Art von Redeangst oder Sprechunsicherheit betroffen sind, und niemand im Team weiß das oder nimmt es ernst?
- Ist Personalverantwortlichen eigentlich klar, was für ein Stressor das ist, welche mentale Belastung diese Angst vor öffentlichem Reden (und damit ist nicht nur das Reden auf großen Bühnen gemeint) für Beschäftigte bedeuten kann? Ist ihnen bewusst, was die aus meiner Sicht unterschätzten Konsequenzen für den Arbeitsalltag oder für die Karriere sind?
- Würde sich etwas für die betroffenen Mitarbeiter*innen, für Führungskräfte, für Teams, fürs ganze Unternehmen ändern, wenn wir offener mit Unsicherheiten und Schwächen umgehen würden?
Redeangst ist weit verbreitet.
Seit 2011 gebe ich diesen Kurs zweimal jährlich an der VHS in Düsseldorf, er erfreut sich einer stabilen Nachfrage. Auch in meinen anderen Rhetorik-Seminaren ist die Frage, wie wir mit Lampenfieber (im „einfachsten“) oder Sprechangst (im „schlimmsten“ Fall) umgehen, ein sehr zentrales Anliegen. Der tiefe Wunsch, diese unangenehmen, teils unerträglichen Gedanken und Gefühle sowie die damit einhergehenden Symptome loszuwerden, ist groß.
Was also meine erste Frage angeht, so ist mir klar, dass ich (und andere Trainer*innen, die sich diesem Thema widmen) mit meinen Kursen und Seminaren nur einen Bruchteil der Menschen erreiche, die betroffen sein könnten. Auch wenn Studien belegen, dass Sprechangst eine der weitverbreitetsten ist, ist längst nicht bei allen Betroffenen die Notwendigkeit gegeben, der Leidensdruck so groß oder die Motivation so hoch, etwas an ihren Sprechunsicherheiten zu verändern.
Das ist auch völlig ok.
Redeangst ist eine Belastung für Mitarbeiter*innen im Arbeitsalltag.
Was meine zweite Frage angeht, so ziehe ich Schlüsse v. a. aus dem, was meine Teilnehmer*innen schildern:
Bei wichtigen, besonderen Terminen oder Aufgaben, die Reden vor größeren, aber eben auch kleinen Gruppen mit sich bringen, sind sie Stunden vorher, teils sogar tage- oder wochenlang im Vorfeld mit Stresssymptomen konfrontiert, die sie drastisch beeinflussen.
Ursachen für die Redeangst scheinen u. a. hohe Ansprüche und (übertriebene) Erwartungen an sich selbst zu sein, kombiniert mit Versagensängsten und Sorge, das Gesicht vor Kolleg*innen, Vorgesetzten, Externen zu verlieren. Es sieht ganz danach aus, als seien die Befürchtungen immens groß, nicht der eigenen Qualifikation oder der Position angemessen als genügend „kompetent, professionell, redegewandt“ dazustehen. Dadurch entsteht sowohl ein innerer als auch ein (stark empfundener) äußerer Leistungsdruck.
Auch negative Redeerfahrungen in der Vergangenheit können ein Stressauslöser sein. Dies wird jedoch in meinen Kursen sehr viel seltener angeführt als ich früher selbst vermutet hätte.
Wer also mentale Symptome wie schlechte Gedanken, Sorgen, Nöte, Ängste oder/und physische Symptome wie Herzrasen, Atemnot, Zittern, Übelkeit, Schweißausbrüche vor und während der zu leistenden „Redeaufgabe“ erlebt, ist zusätzlich belastet. Es kostet die betroffene Person viel Überwindung, Energie und Kraft, um einerseits damit umzugehen und gleichzeitig die eigentliche Kernaufgabe – wie das Unternehmen zu repräsentieren, Projekte vorzustellen, die Teambesprechung zu leiten – professionell erfüllen zu können.
Manch eine*r mag sagen: „Das bisschen Aufregung gehört doch dazu! Gerade das bringt mich zu Höchstleistung!“
Dem stimme ich auch bis zu einem gewissen Grad zu.
Doch es gibt einen Wendepunkt, an dem positive, motivierende, aufmerksamkeitssteigernde Aufregung kippt in Handlungs- und Redeunfähigkeit (wie Blackouts). Und – zumindest meiner Erfahrung nach – solange die Betroffenen die mit der Aufregung einhergehenden Symptome als negativ empfinden und sie als störend, einschränkend, bedrohlich bewerten, ist die Aufregung auch nicht leistungssteigernd, sondern eine Ablenkung, die stark hemmt.
Konkreter Anlass, Motivation und Gründe, aus denen sich erfahrene Berufstätige sowie Einsteiger*innen insbesondere zu meinem Kurs „Sprechunsicherheiten bewältigen“ anmelden, sind sicherlich vielfältige. Alle Teilnehmer*innen eint ein gemeinsames Ziel:
Den Makel der Unsicherheit abzuschütteln, die Symptome ganz loszuwerden oder wenigstens etwas souveräner, selbstsicherer vor anderen sprechen zu können.
Redeangst kann negative Auswirkungen auf die Karriere haben.
Oft höre ich von Teilnehmenden Aussagen wie:
„Bei mir steht ein neuer Verantwortungsbereich im Unternehmen an. Da gehört es dazu, vor dem Team / den Mitarbeiter*innen präsentieren zu können. Leider bereitet mir das Bauchschmerzen.“
„Mein*e Kolleg*in / Vorgesetzte*r XY übernimmt meistens den Redepart, wenn eine Moderation oder ähnliches ansteht. Das geht aber nicht auf Dauer und er/sie versucht auch immer wieder, mich dahingehend zu pushen und zu motivieren.“
„Viele Jahre habe ich solche Situationen und Aufgaben erfolgreich vermieden, aber wenn ich beruflich weiterkommen will, muss ich das Thema endlich mal angehen.“
„Ich habe eine Stelle angenommen, in der die Moderation von Workshops dazugehört. Ich dachte, es nimmt nur einen kleinen Teil ein, das könnte ich schaffen. Da habe ich mich jedoch geirrt. Wenn ich meine Redeangst nicht in den Griff kriege, muss ich mir einen neuen Job suchen.“
Redeangst scheint für manch eine Person also ein echter Karrierehemmer zu sein. Sie bedroht die ersten oder nächsten Karriereschritte.
Ist das nicht nur für die Betroffenen ganz individuell äußerst bedauerlich, sondern auch für ein Unternehmen wirtschaftlich betrachtet fatal, wenn qualifizierte Mitarbeiter*innen ihr Potential nicht voll nutzen können oder Aufgaben nicht übernehmen, weil sie (zu sehr) mit ihrer Angst vor öffentlichem Sprechen beschäftigt sind und nicht wagen, darüber zu reden?
Ein bewährtes Mittel gegen Redeangst: Rhetorik-Seminare.
Was also hilft?
Aus meiner Sicht, in aller Kürze: positives Bestärken, konstruktives, ehrliches Feedback, Video-Aufnahmen, sich immer wieder herausfordernden Redesituationen stellen, Übungsräume ohne Leistungsdruck schaffen, mehr Gelassenheit und weniger Perfektionszwang. Gemeinschaft erleben, frei nach dem Motto „Wir sitzen alle im selben Boot“.
Sich bewusst machen: Sprechen vor Gruppen ist für viele herausfordernd. Missgeschicke und Redepannen können passieren. Unsicherheiten sind menschlich und längst nicht immer nach Außen erkennbar. Oft wirken sie sympathisch oder sorgen für Auflockerung. Sie verbinden uns mit Publikum und Gesprächspartner*innen.
Wenn ich zurückdenke an meine Ausgangssituation, fühlen sich diejenigen, die einen offenen Kurs wie meinen buchen, offenbar sicherer und geschützter in einem zunächst anonymen Rahmen. Die Teilnehmer*innen treffen unbelastet aufeinander, es gibt keine beruflichen Abhängigkeiten, keine hierarchischen Ebenen, keine schwierigen Beziehungen unter Kolleg*innen. Ähnliche Motive und Erwartungen schaffen meist schnell Gemeinsamkeit und Vertrauen. Daher trauen sie sich auch für gewöhnlich offener über Hemmungen, Ängste, sogenannte Schwächen, Fehler, unangenehme Situationen, schlechte Gedanken oder Erfahrungen zu reden als in einer Inhouse-Veranstaltung.
Da die Gefahr wesentlich geringer ist, auf Kolleg*innen zu treffen, brauchen sich die Teilnehmenden also keine Sorgen zu machen, dass der vermeintliche Makel öffentlicher als gewünscht wird. Das professionelle Gesicht kann somit gewahrt werden.
Redeangst offen kommunizieren, als Chance zur Stärkung der Team-Kommunikation.
Was schließlich meine dritte Frage angeht, überlege ich, ob und wenn ja, welchen positiven, fördernden Einfluss ein Inhouse-Seminar ganz allgemein zu Rhetorik & Public Speaking oder spezifisch zu Umgang mit Aufregung, Sprechunsicherheiten, Lampenfieber auf ein Team, auf den Zusammenhalt sowie auf die gesamte Kommunikation innerhalb einer Organisation oder eines Unternehmens haben könnte …
Damit so eine Inhouse-Veranstaltung einen positiven, motivierenden, ja sogar leistungssteigernden Effekt haben kann, bedarf es einer vertraulichen Atmosphäre. Sie ist aus meiner Sicht Voraussetzung dafür, dass Kolleg*innen bereit sind, sich auf einen Prozess einzulassen, in dem sie nicht nur ihre vorhandenen Rede-/Gesprächskompetenzen sowie sich selbst (ausschließlich) in positivem Licht darstellen müssen, sondern auch ihre Kommunikationsschwächen & ‑unsicherheiten ehrlich, ohne Scheu zeigen dürfen.
Gegebenenfalls sind besondere Vereinbarungen erforderlich, wie
- gemeinsam vereinbarte Umgangsregeln,
- mindestens mündliches Agreement der Vertraulichkeit,
- wertschätzendes, konstruktives Feedback,
- Betonung von Freiwilligkeit bei Übungen und
- Zusicherung, dass Teilnahme keine Auswirkung auf Position oder Aufgaben hat.
Sofern das gelingt, bietet ein Inhouse-Seminar erfahrungsgemäß die Möglichkeit für einerseits individuelle Persönlichkeitsentwicklung, andererseits für bereichernden Wissens- & Erfahrungsaustausch, bei dem Beschäftigte voneinander lernen können (auch im Sinne von best practices). Sie begegnen sich zwar im beruflichen Kontext, sind aber dennoch losgelöst vom Tagesgeschäft. Dadurch eröffnen sich Chancen zu neuen, im Idealfall abteilungsübergreifenden Perspektiven, zu gegenseitigem Verständnis für die unterschiedlichen Gegebenheiten oder kommunikativen Herausforderungen im Unternehmen.
So eine Veranstaltung kann Beitrag zu mehr Vertrauen und Verbindung sein!
Eine vielversprechende Basis für effektive, erfolgreiche Zusammenarbeit.
Daher, an alle Personalverantwortlichen, Führungskräfte, Teamentwickler*innen:
Investieren Sie ruhig mal in eine Inhouse-Rhetorik-Schulung!
Selbst wenn es keinen offenkundigen Bedarf, keine konkrete Frage nach einer Weiterbildungsmaßnahme, keinen direkt messbaren Nutzen geben sollte.
Ich bin überzeugt, es ist
- eine vertrauensstiftende, teambildende Maßnahme,
- ein sinnvoller Beitrag für eine offene Kommunikation untereinander,
- eine klasse Möglichkeit, Mitarbeiter*innen gezielt zu fördern,
- ein besonderer Ausdruck von Wertschätzung und
- eine Stärkung der Unternehmens-, Fehler- & Feedback-Kultur.
Neugierig geworden? Dann freue ich mich auf ein unverbindliches Kennenlerngespräch.